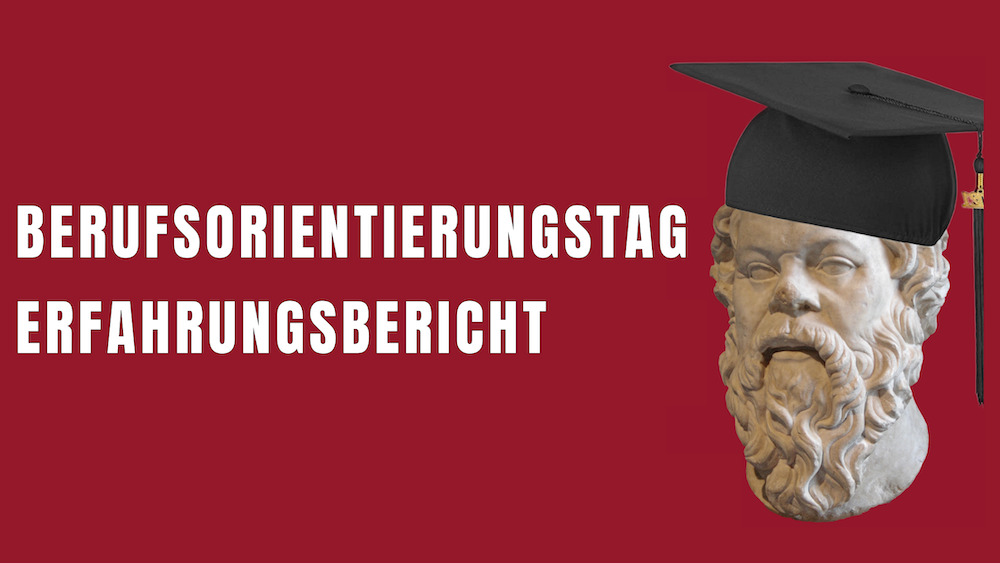von Hasancan Gülenci
Jedem und jeder Geschichtsstudent*in stellt sich im Verlauf des Studiums, mindestens aber im Gespräch mit den Eltern, die Frage: Was kann man mit Geschichte eigentlich machen? Das Berufsfeld unseres Abschlusses ist nicht klar umrissen, insbesondere im Bachelor und Master. Der Ruf einer brotlosen Kunst haftet unserem Studiengang an. Geisteswissenschaftler seien nur für Nischenjobs geeignet und studieren eigentlich sinnlos vor sich hin. Aber stimmt das überhaupt? Sind Geschichtsstudent*innen wirklich so hilflos auf dem Arbeitsmarkt, wie gemeinhin behauptet wird? Um diese Fragen beantworten zu können, besuchte ich den Berufsorientierungstag der Fachschaft Geschichte am Freitag, den 03.05.2024.
Die Sprecher*innen kamen aus verschiedenen Institutionen und Berufsfeldern. Ihr oftmals nicht geradliniger Lebenslauf zeigt die enorme Flexibilität, die unser Studentendasein mit sich bringen kann. Jeder der Sprecher*innen hielt für jeweils eine Stunde einen Vortrag, wobei sie ihren eigenen Lebensweg sowie den jeweiligen Beruf darstellten.
Als erstes sprach Dr. Eva Tyrell aus dem Public History Kulturreferat. Sie studierte an der LMU Lehramt Gymnasium und verbrachte viel Zeit im Ausland, insbesondere in Tel Aviv. Dies bewog sie unter anderem, Hebräisch zu lernen. Ihr Studium schloss sie dann in Paderborn ab. Ihre Arbeit im Kulturreferat setzt es voraus, alte Akten vor allem aus dem 19. Jahrhundert eingehend zu begutachten. Das Kulturreferat betreut Projekte im Bereich Bildende Kunst, Film, Bildung, Stadtgeschichte, Denkmalsarbeit, Erinnerungskulturen und Urbane Kulturen. Dr. Tyrell gab uns Studierenden mehrere gute Tipps: Man sollte sich, wo immer es ging, um Stipendien bewerben. Das kann sogar manchmal einfacher sein, als man denkt. Auch könnte hilfreich sein, den Kontakt zu Menschen zu suchen, die einem helfen können, einen Einstieg in einen Berufszweig vorzunehmen.
Des weiteren meinte sie, dass es sehr nützlich für eine*n angehenden Masterabsolvent*in sei, die Masterarbeit jemandem vorzustellen, um so Feedback zur Arbeit zu erhalten. Dr. Tyrells Arbeit im Kulturreferat setzt voraus, dass man gerne im Team und vernetzt arbeitet. Einsame Wölfe würden es im Kulturreferat schwer haben. Ihre Arbeitszeiten sind flexibel und sie hat auch viel Homeoffice. Aber natürlich hat ihr Job auch weniger angenehme Seiten: Die Stadt bearbeitet Angelegenheiten sehr langsam und die Teamarbeit erschwert es manchmal, genauestens abzuklären, welches Teammitglied welche Aufgaben übernimmt. Aber dennoch sei der Beruf sehr interessant. Einer ihrer Tipps war besonders interessant: Was man tatsächlich unternommen hat und welche Aktivitäten man als Student anpackte, (Praktika, Auslandsaufenthalte) kann manchmal wichtiger sein, als der jeweilige Uni-Abschluss.
Generell bemerkte ich einen Grundtenor bei den Sprechern: Es ist von Vorteil, sich auch außerhalb der Uni um Aktivitäten, Jobs, Auslandsaufenthalte, etc. zu bemühen. Es können sich ungeahnte Möglichkeiten eröffnen, es liest sich gut im Lebenslauf und es hilft einem selbst, sich weiterzuentwickeln. Als ehemaliger Stubenhocker bin ich geneigt, diesen Ratschlägen Gehör zu schenken.
Als nächster Sprecher trat Dr. Paul-Moritz Rabe für das NS-Dokuzentrum als Sprecher auf. Dr. Rabe studierte an der LMU Lehramt Gymnasium Deutsch/Geschichte von 2004 bis 2012. Sein Berufsweg ging über mehrere befristete Stellen, darunter auch zunächst im NS-Dokuzentrum. Dr. Rabe arbeitet momentan an einem Erinnerungsprojekt über Zwangsarbeiter. Dafür sucht und interviewt er Zeitzeugen. Er war auch an der Entwicklung eines Handyspieles beteiligt: Forced-Tage eines Zwangsarbeiters. Also soll mir mal keiner sagen, Historiker*innen hätten keine nützlichen Fähigkeiten zu bieten. Auch er brachte mehrere gute Tipps ein: laut ihm ist es am besten, sich in dem Bereich einzubringen, für den man brennt. Eine Doktorarbeit ohne Sinn zu schreiben, sei laut ihm nicht empfehlenswert, man solle sich schon vorher darüber Gedanken machen. Museums-Volontariate, Vermittlungen, Sammlungen, Kuratorien und Zufälle sind laut ihm gute mögliche Berufseinstiege. Also: Augen auf, angehende Historiker*innen! Apropos einbringen: Dr. Rabe meinte, dass Forschung und Kuration von einem Doktortitel profitieren, aber kein Muss seien. Volontariat sei auch ohne Doktortitel möglich.
Maria Stehr aus dem Hauptstaatsarchiv hatte ebenfalls interessante Sichtweisen zu bieten. Sie schloss in Geschichte ihren Magister ab. Ihre Tätigkeit als Archivarin ist sehr abwechslungsreich und verlangt von ihr viel Spontanität ab. Das war unter anderem daran zu erkennen, dass sie für den Berufsorientierungstag spontan für eine erkrankte Kollegin einsprang und das erst an dem Tag erfuhr, an dem dieser Berufsorientierungstag stattfand. Sie merkte an, dass es von Nachteil für sie wäre, als Archivarin kontaktscheu zu sein. Teamarbeit und Bereitschaft zur Kontaktaufnahme sind auch hier das A und O. Archivare beraten Träger, bewerten und übernehmen analoge und digitale Unterlagen. Archivare legen fest, was ins Archiv kommt und was vernichtet wird. Dokumente und Akten müssen sorgfältig aufbewahrt und verwahrt werden. Ausstellungen und Vortragsreihen werden ebenfalls von ihnen organisiert. Unerlässlich in diesem Beruf sind Lateinkenntnisse, da viele Dokumente aus dem Mittelalter stammen. Archivar wird man, indem man Archivarschulen besucht. Die drei Ausbildungsstätten sind die Archivschule Marburg, die Bayerische Archivschule und die Fachhochschule Potsdam. Allerdings sind die Zeiten für den Ausbildungsbeginn immer unterschiedlich. So lässt eine Stätte nur alle drei Jahre neue Auszubildende zu.
Die nächsten drei gemeinsamen Sprecher dürften den meisten Lesern bekannt sein: Prof. Dr. Julia Burkhardt, Dr. Paul Otting und Prof. Dr. Kärin Nickelsen sprachen für den Berufsweg der Wissenschaft. Wie kommt man nun aber in die Wissenschaft? Reiner Zufall bei Paul Otting. Julia Burkhardt entwickelte während ihres Studiums ein Interesse für das Mittelalter. Sie machte ein Praktikum in Warschau und nahm an Forschungsprojekten teil. Kärin Nickelsen studierte zunächst Biologie und fand dabei Wissenschaftsgeschichte als Nebenfach. Sie arbeitete in dem Bereich zunächst als Hilfskraft und schrieb dann ihre Dissertation. Julia Burkhardt hatte nach der Promotion befristete Stellen an Unis. Bis zur Habilitation hat sie sich für mehrere Jobs beworben, aber Unterrichten hat ihr immer Freude gemacht. Wissenschaftler zu werden, war für sie ein Prozess, keine bewusste Entscheidung. Dennoch sollte man nicht planlos durch die akademische Welt gehen. Kärin Nickelsen hatte keine große Möglichkeit zu reisen während ihrer Anfangsphase, wurde aber von ihrem Chef sehr unterstützt. Ein guter Chef*in ist sehr hilfreich aufgrund dessen langjährigen Erfahrungen. Man muss, laut den Professorinnen, nicht unbedingt ins Ausland gehen.
Dr. Otting meinte, Auslandserfahrungen können trotzdem sehr hilfreich sein. Also nur keine Scheu, bewerbt euch für Auslandsaufenthalte, meine lieben Mitstudenten*innen. Intrinsische Motivation ist ungemein wichtig bei einer Promotion. Man sollte aber auch nicht-wissenschaftlichen Jobs gegenüber offen sein. Es gab auch gute Tipps zur Masterarbeit bzw. Promotion. Die Masterarbeit ist ein guter Testlauf für eine Promotion, da man dort sechs Monate lang mit sich selbst beschäftigt ist. Im wissenschaftlichen Bereich wird die Work-Life-Balance als sehr angenehm bezeichnet. Man entscheidet selbstständig, wie viel man arbeitet. Klare Arbeitsbedingungen sind für Mitarbeiter ein Muss. Finanzierung ist mit Stipendium und Assistenzstelle möglich. Eine Stipendienberatung mit Frau Probst ist dementsprechend zu empfehlen. Um eine Hilfskraft zu werden, gibt es einen einfachen Tipp: Man muss auf Professoren zugehen und sich bei ihnen um Stellen bewerben. Im dritten Stock bei Herrn Freytag hängen meistens Stellenausschreibungen. Bei Hiwi-Stellen sollte man darauf achten, dass Chef und Mitarbeiter zu einem passen.
Für alle, die gerne mit Medien zusammenarbeiten, dürfte der nächste Sprecher interessant sein: Niklas Fischer vom Podcast „Tatort Geschichte“. Dieser wird vom BR produziert. Die gute Nachricht: Geschichtspodcasts boomen. Sie haben sich von einem Nischendasein zu einem Mainstreammedium entwickelt und dürften einer der Gründe sein, weshalb viele Menschen an Geschichte heutzutage ein so hohes Interesse haben. Herr Fischer fing seinen Podcast im ersten Corona-Semester an. Er war ursprünglich als Hilfe für Studenten*innen im Online-Seminar konzipiert und entwickelte sich aus dieser Idee irgendwann zum Podcast „Tatort Geschichte“. Einen Podcast zu erstellen, ist allerdings kein Zuckerschlecken und erfordert eine gute Planung. Crosspromo ist bei Podcasts wichtig: Man nimmt dabei mit bekannteren Podcaster*innen oder anderen öffentlichen Figuren zusammen auf, um auf sich aufmerksam zu machen. Gute Technik ist für einen guten Podcast unerlässlich. Starke Momente im Podcast sind wichtig. Um einen Podcast zu erstellen, geht man wie folgt vor: Ein Thema mit genug Relevanz und Themen wird dem Team um die Podcastproduktion vorgeschlagen.
Der Redakteur*in gibt grünes Licht. Man liest sich ein und danach wird der erste Entwurf geschrieben. Die Fakten werden überprüft und Anmerkungen werden gemacht. Nach der Aufnahme wird das Material von dem Redakteur geschnitten. Die vorgeschnittene Version wird angehört und weitere Schnittwünsche werden geäußert. Danach gibt es einen finalen Schnitt. Die Folge wird veröffentlicht. Es gibt Werbung über Social Media und danach Rückmeldungen von Zuhörer*innen. Das Script wird nicht eins zu eins gesprochen. Live Events von bekannten Podcastern sind für gewöhnlich gut besucht. Von der Redaktion kommen Anmerkungen, Bitten und Anweisungen. Man muss unnötige Details auslassen, didaktische Reduktion ist das Zauberwort. Hier heißt es, das Wesentliche zu erkennen und es von dem Unwichtigen zu trennen. Dies ist eine unverzichtbare Aufgabe.
Als vorletzter Sprecher trat Dr. Jörn Retterath vom Institut für Zeitgeschichte (IFZ) auf. Jörn Retterath arbeitet an diesem Institut in der Position des Referenten des Direktors. Dabei koordiniert er interne und externe Anfragen. Er hält Rücksprache mit dem Direktor, recherchiert für den Direktor und vernetzt und repräsentiert das Institut. Forschen ist in seiner jetzigen Situation bei ihm eine Seltenheit. Er braucht solide Kenntnisse des Wissenschaftsfeldes und der aktuellen Forschungstrends, sprachliche Stilsicherheit, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, die Fähigkeit mit Stress umzugehen, den Überblick und muss Termine im Auge behalten, Loyalität und Integrität sowie das Vertrauen des Direktors. Er studierte von 2004 bis 2009 in Augsburg und war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFZ. Er promovierte in Geschichte an der LMU, absolvierte 2014 ein Verlagsvolontariat und war danach Mitarbeiter im IFZ. Er absolvierte Praktika im Journalismus und Archiv, war studentische Hilfskraft, freiberuflich als Lektor tätig und machte eine Ausbildung als Tour-Guide im Konzentrationslager Dachau. Das IFZ ist laut ihm ein ungewöhnliches Berufsfeld für Historiker. Für eine Promotion ist es eine gute Stelle, was ihm zugute kam, da in seiner jetzigen Stelle eine Promotionen sehr wichtig ist. Kenntnisse im digitalen Bereich können einem weiterhelfen, weshalb es hilfreich sein könnte, sich beim Digital Humanities Programm zu bewerben. Forschungsmanagement scheint auch beliebt zu sein. Hilfskraftjobs sind auf der IFZ-Homepage aufgelistet und können dort eingesehen werden. Ein klar umrissenes Berufsbild für Mitarbeiter gibt es nicht. Jörn Retterath meinte, dass sich der Berufseinstieg schwierig gestalten kann, aber zumeist klappt es nach einem Jahr. In der Regel findet man was. Man sollte sich offensiv verkaufen. Hilfreich und wichtig sind hierbei Praktika-Erfahrungen sowie der Master-Abschluss. Diese sehen gut im Lebenslauf aus.
Der letzte Sprecher des Tages war Merlin Wassermann, der als freier Journalist arbeitet. Er entschied sich für Journalismus und gegen eine Promotion, weil er sich gut im Praktikum zurechtfand, die Uni zu stressig fand und sich gerne mit mehreren Themen beschäftigte. Er arbeitet 3 Tage die Woche bei der Süddeutschen Zeitung (SZ). Die restliche Zeit schreibt er freiberuflich. Wöchentlich arbeitet er ungefähr 40 Stunden. Er mag es, wie abwechslungsreich sein Job ist, wie viel er dabei lernt und wie viele Freiheiten er hat, er liest und schreibt als Hauptbeschäftigung und hat eine sinnvolle Arbeit. Allerdings gibt es natürlich auch Schattenseiten: Er hat ein verhältnismäßig geringes Einkommen, die Selbstständigkeit ist prekär, die Themen sind manchmal öde, er arbeitet viel alleine und die Zukunft des Journalismus ist unsicher. Die Wege in den Journalismus sind mannigfaltig: LMU-Zeitschriften, der studentische Radiosender M94.5, LMU-Workshops beim Schreibzentrum, Praktika, Freie Mitarbeit, Journalistenschule oder Volontariate. Eine Anforderung seines Berufsfeldes ist es, dass man viel lesen und schreiben muss über Themen, die man kennt. Wichtig dabei ist das Anchoring, also Debatten im Blick behalten, und aktuelle Ereignisse verfolgen und sich darüber Gedanken zu machen.
Bei einem Exposé sollte man sich möglichst kurz halten, aber auch zeigen, dass man Ahnung hat. Wie dem Leser schon klar sein dürfte: hier muss wieder Wichtiges von Unwichtigem getrennt werden. Digitalisierung ist wichtig für den Job. Stipendien können ebenfalls von großem Vorteil sein. Artikel für das Spektrum zu schreiben, ähnelt teilweise einer Hausarbeit. In diesem Falle dürften wir Studenten*innen uns ganz wie zuhause fühlen. Weiterhin meinte Herr Wasserman, sind folgende Fähigkeiten von Vorteil: Gute Mails schreiben, sie kurz und knackig formulieren, viel Text lesen und absorbieren, gut zuhören, Konfliktfähigkeit und Fairness sowie kritische Distanz. Sich mit anderen Menschen zu vernetzen, ist ebenfalls hilfreich. Die Arbeitszeiten pro Artikel sind unterschiedlich und können nicht genau benannt werden. Als Journalist ist er oft im Deutschen Museum, um zu recherchieren. Er kennt viele Journalisten, die nie auf einer Journalistenschule waren, was zeigt, dass der Weg in dieses Berufsfeld nicht immer geradlinig sein muss. Aber das haben wir ja im Artikel bereits mehrmals angesprochen.
Die Sprecher*innen haben wertvolle Beiträge geleistet und interessante Informationen geliefert. Die Möglichkeiten unseres Studienganges sind vielfältiger, als gemeinhin angenommen wird. Viele waren mir selber vorher nicht klar. Es ist aber auch beruhigend zu sehen, wie viele Möglichkeiten Geschichte als Studienfach bietet. Hoffentlich finden wir alle gleichsam unseren Weg. Und wer weiß? Vielleicht wird eines Tages ein Leser dieses Artikels an einem Berufsorientierungstag teilnehmen. Und zwar als Sprecher.
Layout: Chiara Vetrano
Header: Jonas Rodewald